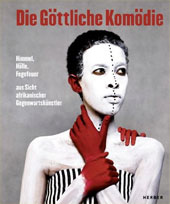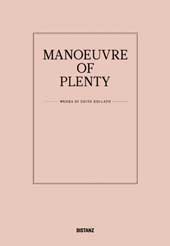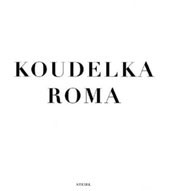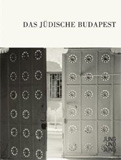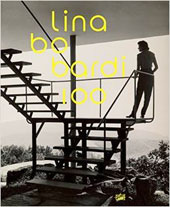Hrsg. von Andres Lepik und Simone Bader
Lina Bo Bardi 100
Brasiliens alternativer Weg
in die Moderne
Mit Texten von Renato Anelli, Vera Simone Bader, Anna Carboncini,
Gabriella Cianciolo Cosentino, Sabine von Fischer, Steffen Lehmann,
Andres Lepik,
Zeuler R.M. de A. Lima, Olivia de Oliveira, Catherine Veikos, Guilherme
Wisnik
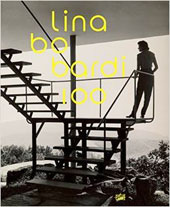
Hatje Cantz Verlag, 2014
Die Casa de Vidro, das Gläserne Haus, war der erste
programmatische Bau, den die italienische Architektin, 1951, im
Stadtteil Morumbi, in São Paulo verwirklichte, nachdem sie zusammen mit
ihrem Ehemann Pietro Maria Bardi nach Brasilien umgesiedelt war. Das
schlichte gläserne Gebäude, das auf langen dünnen Betonpfeilern über der
umgebenden Landschaft ruht, sollte zeitlebens das Wohnhaus Lina Bo
Bardis bleiben. Später erhielt sie den Auftrag für den Bau des Museums
für Moderne Kunst in São Paulo (MASP). Beide, das Wohnhaus wie der
Museumsbau, waren der Moderne verpflichtet. Der brutale Kubus des MASP,
schwebt, mit roten Stahlträgern wie mit Klammern gehalten, über der
darunter entstandenen freien Fläche und sticht noch heute mit der Farbigkeit
der Träger und der „liegenden“ Gestalt des Baukörpers vom, durch das
helle Grau der Hochhäuser geprägten Stadtpanorama ab. Bo Bardis Idee
einer vegetabilen Textur für die Außenwände des MASP, die im Dialog mit
den Jahrhunderte alten Bäumen des nahe gelegenen Trianon Park stehen
sollte, konnte aus statischen Gründen nicht verwirklicht werden. In den
1960er Jahren standen solche Konzepte der Einbindung landschaftlicher
und vernakulärer Elemente in die Architektur allerdings noch in starkem
Widerspruch zu den internationalen Stilvorstellungen.
Die Verbindung von Natur und Architektur und die Empathie für den
lokalen kulturellen Kontext spielten schon bei der Planung des Gläsernen
Hauses eine Rolle, bei der die hoch wachsenden Bäume und Sträucher in
die architektonische Gestaltung einbezogen wurden. In den Projekten in
Salvador de Bahia, mit der ausgeprägten afrikanischen Kultur der „Region
Nordeste“ Brasiliens, erhielt Bo Bardi noch mehr Raum, ihr
eigenwilliges, seiner Zeit vorauseilendes Architekturverständnis zu
realisieren, zumal sie dort auf den Reichtum einer traditionellen und
lebendigen Kultur zurückgreifen konnte.
Das Operieren mit Gegensätzlichem und dessen Auflösung zeigt Lina Bo
Bardis enge Verbundenheit mit dem Surrealismus. In den Jahren der
brasilianischen Militärdiktatur schriebt sie: „In historisch schwierigen
Zeiten, in denen Strukturen zusammenbrechen, ist die Mystik die letzte
Möglichkeit, um die Menschheit vor Passivität zu bewahren.“ Ganz ähnlich
formulierte es der, mit Bo Bardi befreundete Regisseur des „Cinema
Novo“, Glauber Rocha, der in der Mystik die einzige Sprache sah, das
rationale Schema der Unterdrückung zu transzendieren. Wie der Regisseur
in seinen Filmen versuchte Lina Bo Bardi als Architektin eine Synthese
aus alter und avantgardistischer Kultur zu schaffen, eine hochgradig
originelle Vereinigung zwischen archaischer und moderner Welt. Es ging
ihr um den Erhalt der indigenen, amerikanischen und afrikanischen
Kulturen, weshalb sie sich von Beginn an mit Mario Andrades
Antropophagie-Bewegung identifizierte, die eine „Revolution gegen
das Künstliche, gegen das Unauthentische“ formulierten, wie Olivia de
Oliveira in ihrem Essay zitiert.
Der Katalogband, der zur Ausstellung anlässlich Lina Bo Bardis 100stem
Geburtstag am 5. Dezember 2014 in der Pinakothek der Moderne in München
erschien, streicht in seinen zehn Essays vor allem die ausgeprägte
Vorreiterrolle Bo Bardis heraus, die Bedeutung des Vernakulären und die
besondere anthropologische und humanistische Qualität ihrer
Architekturprojekte.
Ihr gläsernes Wohnhaus, das heute das Instituto Lina Bo e P. M. Bardi
beherbergt, ist inmitten der Bäume luftig, durchsicht, klar, die Casa do
Chame-Chame, im Kontrast, von einer vertikalen Natur eingefasst und
spiralförmig, geradezu verschlungen, konzipiert. Hochabstrakte
Gestaltungsformen brechen vernakuläre Elemente und umgekehrt. Das
Kunstmuseum, die Casa do Benin will auf die kulturelle Beziehung Bahias
zu dem westafrikanischen Benin hinweisen, von wo die Menschen als
Sklaven nach Brasilien verschleppt wurden. In São Paulo transformierte
Bo Bardi eine leer stehende Ölfässerfabrik in eine gigantische,
zeitgemäße und soziale Freizeitstätte. Zwischen zwei hinzugefügten,
nüchternen Betontürmen, die Sporthallen beherbergen, sind so genannte
„Himmelsbrücken“ gezogen, die einen ständigen Wechsel von innen und
außen, Begegnungen im Hin- und Her und die Verbundenheit in einer
Gemeinschaft symbolisieren.
Neben den Essays lässt der Band, durch ein mannigfaltiges Material von
Skizzen, Designs, Designentwürfen, Plänen, Studien, Fotos von und mit
der Architektin und ältere Abbildungen
von Lina Bo Bardis Bauten im Spiegel aktueller Fotographien, das überaus kreative Leben einer nicht
einfach zuzuordnenden Künstlerin sichtbar werden.
(bpk)
Nächste Rezension
bestellen bei

|
|