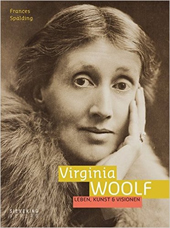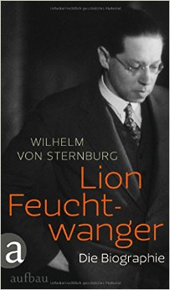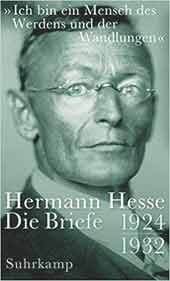|
Hermann Hesse
„Ich
bin ein Mensch des Werdens und der Wandlungen“
Die Briefe 1924 - 1932
Herausgegeben von Volker Michels
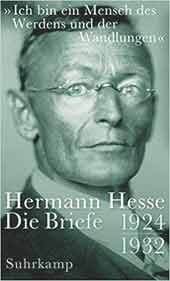
Suhrkamp Verlag,, 2017
Die Briefe, die Hermann
Hesse zwischen seinem 47sten und seinem 55sten Lebensjahr verfasste,
spiegeln eine tiefe körperliche und psychische Krise wider. Im Mai 1925
schreibt er über die Tristesse seines Aufenthalts in Basel, über die
enge Bude, das Essen in Wirtshäusern, über das, was die Eheverhältnisse mit der
jungen Sopranisten Ruth Wenger mit sich bringen:
„Und wenn es mich nicht
fröre und ich nicht auf den Hund gekommen wäre, könnte ich das kleine
Buch jetzt schreiben, das mir diesen Winter in Basel eingefallen ist ...
stattdessen tue ich wieder einmal Kärrnerarbeit und gebe alte Dichter
heraus, so daß es nicht am Opium der Arbeit fehlt.“ Er thematisiert
diesen desolaten Zustand in den Briefwechseln mit Dichterkollegen und
Freunden, wieder und wieder, auch wenn viele dazu diplomatisch schweigen
oder versuchen, ihn von seiner Resignation abzubringen. Und doch vermag
er diese innere Zerrissenheit und seine
„seelischen Spannungen gegen die
Umwelt“ zum Gegenstand seiner Dichtung zu machen und in dieser
Zeitspanne, mit neuen Imaginationen und zunehmend wiedergewonnener
Kreativität, drei seiner literarischen Hauptwerke zu schaffen.
In einem emotionalen Ausbruchsversuch aus dieser Krise - einer Art
psychiatrischen Aufarbeitung, vor allem der tief absorbierten
pietistischen Moraldogmen seines Elternhauses - zieht Hesse mit seinem
Freund Joseph Bernhardt Lang durch die Kneipen im Zürcher Niederdorf.
„Diese Welt einer gewissen Hingegebenheit an das Außen, an Geselligkeit,
Trinken, Tanzen und Frauen ... ist der Boden auf dem der Steppenwolf
wächst“, schreibt er im Frühjahr 1926 an Nino Dolbin, die später seine
dritte Ehefrau wird. Für ihn melden sich
„Lebenswille, Geschlecht und
Begierde“ als Gegenwelle zu seinem zurückgezogenen Leben. Im
Steppenwolf, der zwei Jahre später im Samuel Fischer Verlag
erscheint, verdichtet er diese inneren Bilder und Erfahrungen, aber erst
in den 1960iger Jahren wird das Buch von einer großen, internationalen
Leserschaft wirklich entdeckt, begeistert gefeiert und frei
interpretiert und gelebt.
„Der Dichter lebt nicht davon, daß er den
Lesern hübsche Sachen vorflötet, sondern einzig davon, daß er durch die
Magie des Worts sein eigenes Wesen und Erleben sich selber zeigt und
deutet, sei es hübsch oder häßlich, gut oder böse.“ schreibt er 1927 als
Antwort auf einen kritischen Brief von Helen Welti. Hesses
„ungewöhnliche Geistigkeit" und eine
„ungewöhnliche Sinneskraft“, wären
sich spinnefeind gewesen, schrieb Hugo Ball über den Freund in seiner
Hesse-Biografie. Dieses archaische Spannungsverhältnis lässt Hesse die
Figuren Narziß und Goldmund in seiner neuen Erzählung
verkörpern, worin er wieder sein inneres Erleben und seine Wandlungen
zum Sujet eines Romans macht.
Wie sehr er mit dem Leben, dem Sinn und seiner Wahrhaftigkeit rang,
verdeutlichen viele seiner Briefe an Dichterkollegen, Freunde, Verwandte
oder anonyme Leser seiner Bücher, die in ihrer harschen Authentizität
nicht immer verstanden werden konnten. Hesse will sich nicht mit dem
gemein machen, was er an dem Kunst- und Kulturbetrieb dieser, von
„Krieg,
Technik, Geldrausch, Nationalismus“
zerrütteten Zeit so sehr ablehnt.
Er tritt zum ausdrücklichen Bedauern Thomas Manns als Präsident der
Akademie der Künste zurück, eine Mitgliedschaft im Pen-Club nimmt er
nicht an, weil dessen Strukturen denen eines
„industriellen
Verwaltungsrates“ glichen, wie er Kurt Tucholsky schreibt und eine
Anfrage der Deutschen Buch Gemeinschaft nach einem Beitrag zu Martin
Luther lehnt er ebenfalls ab: Es käme
„nichts Erfreuliches“ dabei
heraus, denn Luther habe
„den
Fürsten assistiert, die Bauern im Stich gelassen, das Schisma und den
30jährigen Krieg verursacht und sei zudem ein übler Antisemit gewesen.“
Auch in seinem privaten Leben hadert Hesse mit bourgeoisem Gehabe.
Seiner Schwester Adele berichtet er über den Weihnachtstag, 1932, mit
Nino Hesse in seinem neu bezogenen Haus in Montagnola. Alles sei
„zu
hübsch“, er möchte keine Dienstboten vor, mit Geschenken überladenen,
Tischen stehen haben, "für die man 14 Tage vorher sich nervös gesorgt
hat“.
Und, dass er an den alten Tolstoi dabei dachte, der sein Leben lang
„aus
den gedeckten Tischen und den wohlhabenden Manieren nicht herauskam und
im Greisenalter heimlich weglief, um wenigstens draußen auf der
Landstraße zu sterben.“
1924 hatte Hesse geschrieben, die Magie läge darin, von der Zeit und der
Außenwelt unbeeindruckt, in dem zu leben, was schön, lebendig und heilig
scheint. Nun verfasst er Anfang der 1930er Jahre, wie aus einer
geistigen Notwendigkeit heraus, die Erzählung Die Morgenlandfahrt,
worin sich, wie er in einem Brief an die Literaturwissenschaftlerin Anni
Rebenwurzel betont, der Versuch eines
„Magischen Theaters“ verdichtet
habe, um einer unsäglich geistlosen Zeit, das Zeitlose vor Augen zu
stellen. Es würde wenig verstanden, notiert er kurz auf einer Postkarte
an Martin Buber, mit einem Dank für dessen gute Aufnahme des Buches.
Tatsächlich scheint sich diese trans-temporale Utopie der
Morgenlandfahrt den meisten Interpretationsideen zu entziehen. Auch
Hesses eigene Anmerkungen und Deutungen dazu sind auf den
unterschiedlichsten Ebenen angelegt. Der Leser bräuchte die Symbolik
nicht verstehen, nicht erklären, er solle die Bilder und ihren Sinn
allein in sich hineinlassen. Angesichts der Schmähungen von
Hitleranhängern gegen ihn, fragt er in einem Brief im Mai 1932 an Karl
Maria Zwissler rhetorisch, was würde
„Leo", die Hauptfigur der
Morgenlandfahrt,
„tun und sagen?“.
„Er würde schweigen und lächeln
und sich bemühen die Schweinerei in der Welt durch ein kleines Plus an
Schweigen, Lächeln, an Wohlwollen und Ruhe etwas zu vermindern.“
(bpk)
Nächste
Rezension
***
bestellen bei

|
|